Hintergrund
Was ist das Ziel der WebApp?
Zielgruppe
Wissenschaftlich fundiert, aber einfach verständlich und mit einer Prise Humor: Die WebApp richtet sich an Leute mit persönlichem und professionellem Interesse, an Lehrpersonen und Schulklassen, und alle Neugierigen und Mutigen, die mehr über die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die Schweiz erfahren möchten. Angesprochen sind insbesondere die Ungeduldigen, die die Fakten gerne in kleinen Portionen verspeisen, die Unerschrockenen, die keine Angst vor Komplexität haben, und diejenigen, die die Zukunft in die Hand nehmen wollen – heute.
Was wird dargestellt?
Anhand von drei unterschiedlich extremen Klimaszenarien zeigt die WebApp auf, welche Auswirkungen Hitzewellen, langanhaltende Trockenheit sowie Starkregenereignisse auf die Umwelt und Gesellschaft in der Schweiz haben können; welche Wechselwirkungen und Kettenreaktionen dadurch ausgelöst werden können; und welche Massnahmen und Lösungsansätze für den Umgang mit Extremereignissen vorliegen oder von der Forschung gegenwärtig entwickelt werden.
Was wird nicht dargestellt?
Eine Handvoll Themen wie Moore, Grasland, auch Veränderungen in der Energieproduktion oder der Einfluss von Anpassungsmassnahmen, zum Beispiel auf die Landwirtschaft.
Einige Zusammenhänge zwischen den dargestellten Bereichen, damit Sie als Nutzer sich nicht in den Wirrungen verirren.
Eine Vielzahl von Lösungen und Massnahmen. Das war nur eine erste Auswahl!
Was steckt hinter den Klimaszenarien?
Die WebApp Extremes betrachtet drei Stufen von Klimaextremen. Alle drei Stufen beschreiben die nahe Zukunft der nächsten 20 Jahre. Je extremer das «Extrem» ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit des Szenarios. Dennoch ist es für die Stufen 1 bis 3 physikalisch konsistent und daher durchaus im Rahmen des Möglichen. Die Stufen 0 und 4 sind keine physikalischen Szenarien und dienen nur der Unterhaltung.
Stufe 1:
Die Extreme der Stufe 1 entsprechen in etwa den Extremereignissen der letzten 10-15 Jahre, die extreme Trockenheit 2003 oder 2018-2020. Es sind also Extreme, die gar nicht mehr so extrem sind, weil sie in den letzten Jahren gehäuft oder wiederholt aufgetreten sind.
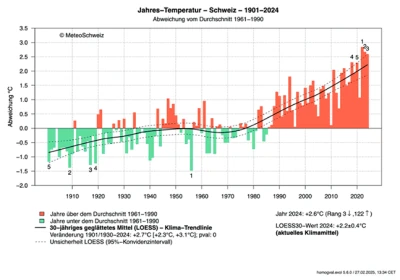
Stufe 2:
Hier werden Extremereignisse dargestellt, wie sie in den offiziellen Klimaszenarien für die Schweiz (CH2018, Link ) bis ca. 2040 aufzufinden sind. Das heisst, sie beschreiben nicht das durchschnittliche, aber das extremere Klima, wie es in mehreren Modellen in naher Zukunft ab und zu auftritt. Die Auswirkungen solcher Klimaereignisse wurden in zahlreichen Studien berechnet oder abgeleitet. Sie werden auf dieser Stufe zusammengefasst.
Stufe 3:
Die extremste Stufe wird durch eher wenig wahrscheinliche, aber physikalisch plausible Szenarien dargestellt, wie sich anhand von Klimamodellen gerechnet werden können, wenn sie in Richtung von Extremen forciert werden. Damit werden Szenarien generiert, die in etwa den Jahrhundert-Ereignissen Kalifornien 2011-2015 oder in Chile (letzte 10-15 Jahre) stattgefunden haben. Diese Ereignisse treten auf, aber nicht sehr oft – die Folgen sind aber potenziell gravierend. Die Auswirkungen solcher Klimaereignisse konnten mangels geeigneter Daten noch nicht modelliert werden. Gegenwärtig werden darin aber Fortschritte erzielt. Die hier beschriebenen Auswirkungen wurden aus Beobachtungen und Studien in anderen Regionen auf die Schweiz übertragen. Daher sind sie weniger gesichert, als die in Stufe 2 beschriebenen Auswirkungen.
Wie untersucht man zukünftige Extremereignisse?
Zur Untersuchung von Extremereignissen werden oft zwei unterschiedliche Methoden angewandt.
Die erste nennen wir «Raum-für-Zeit-Substitution»: Anstatt lokal, also zum Beispiel in der Schweiz, so lange auf Extremereignisse zu warten, bis genügend grosse Datensätzen für deren Analyse zusammengetragen sind, untersucht man Extremereignisse anderswo. Weltweit treten immer wieder und immer häufiger Extremereignisse wie längere Trockenperioden auf. Wenn wir sie dort untersuchen, wo sie auftreten, können wir viele Extremereignisse in kurzer Zeit zusammentragen, analysieren und allgemeine Regeln ableiten (Chen et al. 2025). Nicht alle so gefundenen Ereignisse sind typisch für die Schweiz. Dennoch gibt es viele Ereignisse in anderen Regionen der Welt, die der Schweiz ähnlich, und somit relevant sind.
Der zweite Ansatz basiert auf Modellsimulationen. Wenn sie realistisch sein sollen, müssen sie die Wirkungsketten von Ursache bis Auswirkung korrekt abbilden. Die Wissenschaft hat viele geeignete Modelle entwickelt, von globalen hin zu regionalen Klimamodellen, die unterschiedliche Prognosen für die Klimazukunft liefern können. Einen Schritt weiter gehen die Impact-Modelle, welche die Auswirkungen solch klimatischer Extreme auf Umwelt und Gesellschaft simulieren und dafür extreme Inputdaten benötigen. Plausible Datensätze zu Klimaextremen für spezifische Regionen zu generieren ist sehr anspruchsvoll, weil sie physikalisch konsistent sein müssen und eine ungefähre Eintretenswahrscheinlichkeit angegeben werden muss. Sie lassen sich zum Beispiel aus den riesigen Datenarchiven von Klimamodellen wie den Grundlagendaten für die IPCC-Reports extrahieren (z.B. IPCC 2023). Da solche Archive nicht immer die für eine Region typischen Extreme liefern, lassen sich neu auch extreme Klimaereignisse gezielt simulieren (Gessner et al. 2022, 2023; Fischer et al. 2023), so dass diese anschliessend in Modellen zur Berechnung der Auswirkungen solcher Klimaereignisse verwendet werden können.
Referenzen:
Chen L., Brun P., Buri P., Fatichi S., Gessler A., McCarthy M.J., Pellicciotti F., Stocker B., Karger D.N. (2025) Global increase in the occurrence and impact of multiyear droughts. Science Vol. 387 (6731): 278-284. DOI: 10.1126/science.ado4245
Fischer E.M., Beyerle U., Bloin-Wibe L., Gessner C., Humphrey V., Lehner F., Pendergrass A.G., Sippel S., Zeder J., Knutti R. (2023). Storylines for unprecedented heatwaves based on ensemble boosting. Nature Communications 14(1):4643.
Gessner C., Fischer E.M., Beyerle U., Knutti R. (2023) Developing Low‐Likelihood Climate Storylines for Extreme Precipitation Over Central Europe. Earth's Future 11(9): e2023EF003628.
Gessner C., Fischer E.M., Beyerle U., Knutti R. (2022) Multi-year drought storylines for Europe and North America from an iteratively perturbed global climate model. Weather and Climate Extremes 1;38:100512.
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2023). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001
Was steckt hinter der WebApp?
Die WebApp Extremes wurde im Rahmen des Forschungsprogramms Extremes (2020-2025) der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) entwickelt. Das Programm befasst sich mit Extremereignissen und der Entwicklung von Lösungsansätzen in Zusammenarbeit mit ausserakademischen Partnerinnen und Partnern.
Im Projekt EMERGE werden weltweit Mega-Dürren charakterisiert, um daraus Trends abzuleiten und zu beschreiben, wie sich eine langjährige Trockenheit in Europa und der Schweiz ausprägen könnte.
Das Projekt ExtremeThaw untersucht den Einfluss der Klimaerwärmung auf die Verbreitung von Permafrost in der Schweiz, den damit verbundenen potenziellen Austrag von Schadstoffen, sowie den Einfluss auf die hochalpine Vegetation und die Kohlenstoffbilanz im Gebirgsraum.
Das Projekt MountEx entwickelt digitale Entscheidungshilfen für die zukunftsorientierte Waldbewirtschaftung in Bergregionen. Dort schützen Schutzwälder vor Naturgefahren, werden aber zunehmend selber vom Klimawandel beeinträchtigt.
Im Projekt Malefix entwickelt aufbauend auf einer bestehenden Trockenheitswarnplattform weitere 30-Tage-Vorhersagen zu Borkenkäferpopulationen, Waldbrandrisiken, Fliessgewässertemperaturen, Grundwasserständen etc. Solche Vorhersagen unterstützen die Entscheidungsfindung und Planung.
Im Projekt ALANex wird in Zusammenarbeit mit einem lokalen Energieversorger der Einfluss von Lichtverschmutzung auf nachtaktive Insekten untersucht, um daraus Empfehlungen für die Beleuchtung im öffentlichen Raum abzuleiten.
Wer hat zur WebApp beigetragen?
Die WebApp wurde durch die finanzielle Unterstützung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL ermöglicht. Für die Entwicklung der Inhalte waren, neben dem Forschungsprogramm Extremes und den Projektmitarbeitenden, folgende Personen verantwortlich:
Astrid Björnsen
Niklaus Zimmermann
Kontakt: extremesprogram@wsl.ch
Für das Konzept, die visuelle Gestaltung, Programmierung und die Verpackung der wissenschaftlichen Inhalte in bekömmliche Häppchen: Zense GmbH
Marion Deichmann, Projektleitung und Animation
Madleina Dörig, Illustration und Screendesign
Sven Langone, Animation
Mirko Lemme, Programmierung
Yves Erne, Art Direction
mit Unterstützung des Zense-Teams
Für die Technik:
Christian Wessalowski und Wei Li, IT WSL
Referenz:
Astrid Björnsen, Marion Deichmann, Madleina Dörig, Peter Bebi, Pierluigi Calanca, Martin Gossner, Dirk N. Karger, Petia Nikolova, Tobias Wechsler, Massimiliano Zappa, Niklaus E. Zimmermann (2025) Wie wird das Klima der Schweiz in Zukunft aussehen? WebApp.
Die WebApp ist Open Access. Alle Texte und Illustrationen unterliegen der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0. Sie dürfen unter Angabe der Quelle frei vervielfältigt, verbreitet und verändert werden.
Die WSL haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung oder Benutzung der WebApp verursacht werden.
Themenseiten
-
Klimawandel
+4 °C und mehr: Schweizer Landschaften im Klimawandel. Link
KlimawandelReferenzen:
Klimawirksamkeit von CO2:
Etminan M. et al. (2016) Radiative forcing of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide: A significant revision of the methane radiative forcing. Geophysical Research Letters 43(24): 12614-12623. LinkZusammenhang CO2 und Temperatur:
Arrhenius, S. (1896). On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground. Philosophical Magazine and Journal of Science, 41, 237–276.
Callendar G.S. (1938). The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. LinkTemperaturanstieg und Industrialisierung:
Hansen J et al (2006) Global temperature change. PNAS 103(39): 14288-14293. LinkAuswirkungen des globalen Temperaturanstiegs:
IPCC, 2022. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. LinkRegionalen Auswirkungen:
IPCC (2022) Summary for Policymakers. Pörtner H.O. et al.(eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 3-33, doi:10.1017/9781009325844.001. Link
Bundesamt für Umwelt (2025). Klima-Risikoanalyse für die Schweiz. Grundlage für die Anpassung an den Klimawandel. Umwelt-Wissen, Bern. LinkTemperaturveränderung und wirtschaftliche Produktion:
Burke, M. et al. (2015) Global non-linear effect of temperature on economic production. Nature 527, 235–239. LinkKlimawandel in der Schweiz:
https://www.meteoswiss.admin.ch/climate/climate-change.htmlReduktionsziele des Kyoto-Protokolls (Ziel der Schweiz im Anhang B): Link
Rückkopplungen und Schwellenwerte:
Steffen W. et al. (2018) Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. PNAS 115(33): 8252-8259. Link -
Starkniederschläge
Schweizer Klimaszenarien CH2018: Heftige Niederschläge Link
StarkniederschlägeReferenzen:
Peleg, N., Koukoula, M., Marra F. (2025). A 2°C warming can double the frequency of extreme summer downpours in the Alps. npj Climate and Atmospheric Science 8: 216. Link -
Trockenheit
Seit dem Weckruf durch den Hitze- und Trockensommer 2003 gab es in der Schweiz eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Trockenheit. Mehr als 20 Jahre später ist die Tatsache, dass auch das Wasserschloss Europas, die Alpen, von extremer Trockenheit betroffen sein können, von der Forschung und von Folgeereignissen bestätigt. Auch globale Untersuchungen weisen auf die zunehmende Gefahr von mehrjähriger Trockenheit hin, welche heute noch schwer vorstellbare Folgen für Umwelt und Gesellschaft haben könnten. Unvorbereitet ist die Schweiz dabei nicht: seit 2012 arbeiten Forschung und Verwaltung eng zusammen, um auf zukünftige Trockenheitsereignisse besser gewappnet zu sein.
Weitere Informationen siehe Tagungsband, S. 13, S. 73, S. 87
TrockenheitReferenz:
Zappa M., Karger D.N., Hüsler F. (2025) Extreme Trockenheit in der Schweiz: Regionale und lokale Perspektiven einer globalen Herausforderung. In: Björnsen A. (Red.) Forum für Wissen 2025: Extremes. WSL Ber. 164, 13-21. Link -
Hitze
Hitzewellen stellen weltweit eine grosse Herausforderung dar, unter anderem da diese Extremereignisse schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Durch den Klimawandel haben Intensität, Dauer und Häufigkeit von Hitzewellen in den meisten Regionen der Welt stark zugenommen. Simulationen mit Klimamodellen projizieren, dass der weitere Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre solche Extreme noch stärker begünstigen wird. Vorhersagen können helfen, gefährdete Personen und betroffene Sektoren frühzeitig zu warnen, damit entsprechende Massnahmen ergriffen werden können.
Weitere Informationen siehe Tagungsband, S. 23 und S. 31
HitzeMehr zur Forschung:
Domeisen DIV (2025) Hitzewellen im Klimawandel: Wie gut sind wir vorbereitet? In: Björnsen A., Zimmermann N. (Red.) Forum für Wissen 2025. Extremes. WSL Ber. 164, 23-30. LinkMehr zur Praxis:
Huber N (2025) Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit. In: Björnsen A. (Red.) Forum für Wissen 2025: Extremes. WSL Ber. 164, 31-34. Link -
Gletscherschwund
Wieso Gletscher wichtig sind und was die Forschung tut: Video mit Daniel Farinotti, WSL
Faktenblatt Gletscher in der Schweiz (2025) PDF
GletscherschwundReferenzen:
Ayala, A., Farinotti, D., Stoffel, M., & Huss, M. (2020). Glaciers: Hydro-CH2018 synthesis report chapters:“future changes in hydrology “. ETH Zurich.
Farinotti, D., Pistocchi, A., & Huss, M. (2016). From dwindling ice to headwater lakes: could dams replace glaciers in the European Alps?. Environmental Research Letters, 11(5), 054022. Link
Huss, M., & Hock, R. (2018). Global-scale hydrological response to future glacier mass loss. Nature Climate Change, 8(2), 135-140. Link
Linsbauer, A., Huss, M., Hodel, E., Bauder, A., Fischer, M., Weidmann, Y., ... & Schmassmann, E. (2021). The New Swiss Glacier Inventory SGI2016: from a topographical to a glaciological dataset. Frontiers in Earth Science, 9, 704189. Link
Stahl K., Weiler M., Kohn I., Freudiger D., Seibert J., Vis M., Gerlinger K. 2017: The snow and glacier melt components of streamflow of the river Rhine and its tributaries considering the influence of climate change. Final report to the International Commission for the Hydrology of the Rhine basin (CHR). English version. Report CHR 00-03 2017. Link
Zekollari, H., Huss, M., & Farinotti, D. (2019). Modelling the future evolution of glaciers in the European Alps under the EURO-CORDEX RCM ensemble. The Cryosphere, 13(4), 1125-1146. Link -
Permafrost
Die Veränderungen im alpinen Permafrost finden meist im Verborgenen statt, haben aber Konsequenzen für die Berggebiete. Im letzten Jahrzehnt sind in den Schweizer Alpen die Permafrosttemperaturen um bis zu 1 °C angestiegen und die Auftauschichten um mehrere Meter mächtiger geworden. Auch hat der Eisgehalt im Boden abgenommen und die Blockgletscher haben sich schneller talwärts bewegt als zu Beginn der Messungen vor gut 20 Jahren. Diese grossen Veränderungen im Untergrund bedrohen Hochgebirgsinfrastrukturen und führen zu einer Zunahme von Naturgefahren wie Felsstürzen und Murgängen.
Weitere Informationen siehe Tagungsband, S. 35
PermafrostReferenzen:
Nötzli J., Peter A., Hählen N., Phillips M. (2025) Verborgenes Eis in den Schweizer Alpen: der Permafrost taut immer schneller. In: Björnsen A. (Red.) Forum für Wissen 2025: Extremes. WSL Ber. 164, 35–47. Link -
Gravitative Naturgefahren
WSL-Magazin DIAGONAL 1/25 zu Klimawandel und Naturgefahren: Link
WSL-Forschungsprogramm Climate Change and Alpine Massmovements CCAMM 2018-2025: Link und News WSL
Gravitative NaturgefahrenReferenzen:
Bettzieche J. (2024). Mehr Nass, weniger trocken: Lawinen der Zukunft. WSL News 6.11.2024. Link
Bettzieche J. (2024). Klimawandel führt zu mehr alpinen Gefahren. WSL News 31.10.2024. Link
Eidg. Forschungsanstalt WSL (2025). Stopp! Gefahr! Klimawandel und Naturgefahren. WSL-Magazin Diagonal, 2025/1: 36 S. Link
Jacquemart M., Weber S., Chiarle M., Chmiel M. , … & Markus Stoffel (2024). Detecting the impact of climate change on alpine mass movements in observational records from the European Alps. Earth-Science Reviews 258:104886. Link
Naturgefahrenportal des Bundes: https://www.naturgefahren.ch
Walter et al. (2020) Direct observations of a three million cubic meter rock-slope collapse with almost immediate initiation of ensuing debris flows. Gemorphology 351, 1069333. Link -
Wasserhaushalt
WasserhaushaltReferenzen:
Bundesamt für Umwelt BAFU (2021) Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer. NCCS Hydro-CH2018. Reihe Umwelt Wissen. 134 S. Synthesebericht und Broschüre
Bundesamt für Umwelt BAFU (2023) Hitze und Trockenheit im Sommer 2022. Dossier
Brunner et al. (2019) Beitrag von Wasserspeicher zur Verminderung von zukünftiger Wasserknappheit? Wasser Energie Luft 111(3): 145-152. Link
Compagno et al. (2021). Brief communication: Do 1.0, 1.5, or 2.0 °C matter for the future evolution of Alpine glaciers? The Cryosphere 15(6). https://tc.copernicus.org/articles/15/2593/2021/
Lanz et al. (2021) Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft der Schweiz. Beiträge zur Hydrologie der Schweiz 43, Bern. Link
Padrón, R. S., Zappa, M., Bernhard, L., & Bogner, K. (2025). Extended-range forecasting of stream water temperature with deep-learning models. Hydrology and Earth System Sciences, 29(6), 1685-1702. Link -
Baumvitalität
BaumvitalitätDürre & Buche. Video zur WSL-Forschung.
-
Landwirtschaft
LandwirtschaftReferenzen:
Empfehlungen für die Klimaanpassung:
Agroscope-Dossier "Herausforderung Klimawandel" Link
Wuyts et al. (2023) Klimaresilienter Ackerbau 2035. Agroscope Science 177, 197 S. Link
Heinz et al. (2024) How to find alternative crops for climate-resilient regional food production. Agricultural Systems 213 (103793). LinkAuswirkungen Trockenheit und CO2:
Holzkaemper A. und Calanca P. (2022) Auswirkungen der Trockenjahre 1947, 2003 und 2018 auf die Landwirtschaft. In: Hitze- und Trockensommer in der Schweiz. Hrsg. Geographica Bernensia, Bern. 16-17. Link
Webber et al. (2018). Diverging importance of drought stress for maize and winter wheat in Europe. Nature Communications 9 (4249). LinkBodenfeuchte: Messwerte und Vorhersagen:
www.bodenmessnetz.ch
www.bodenfeuchte-ostschweiz.ch (Ostschweiz)
www.oasi.ti.ch/web/dati/suolo.html (Alpensüdseite) -
Biodiversität
-
Fisch- und Artensterben
Warum ist Hitze für Fische problematisch? SRF Kids News Video Link
Fisch- und ArtensterbenReferenzen:
Bonaglia A, Shen C, Padrón R, Bogner K, Fopp F, Rubin A, Rubin JF, Adde A, Guisan A, Albouy C, Pellissier L (2025). Sub-seasonal forecasting of thermal stress for Swiss river fishes during heatwaves. Ecological Modelling 507, 111171. Link
-
Energieproduktion
EnergieproduktionReferenzen:
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK (2021). Gemeinsame Erklärung des Runden Tisches Wasserkraft. Protokoll 21. Juni 2021. Link
Micocci, D., Bragalli, C., Toth, E., Wechsler, T., Zappa., M. (2025). Hybridization of an Alpine pumped-storage hydropower plant with floating solar photovoltaics: a study from the water resource perspective. Renewable Energy. Link
Otero et al. (2023). Impacts of hot-dry conditions on hydropower production in Switzerland. Env. Res. Letters 18(6): 064038. Link
Stecher G, Herrnegger M (2022) Impact of hydropower reservoirs on floods: evidence from large river basins in Austria. Hydrological Sciences Journal 67(14). Link -
Schutzwaldverlust
Die Zunahme an extremen Störungsereignissen wie Borkenkäferbefall und Windwurf im Kontext des Klimawandels stellt die Schweizer Waldbewirtschaftung vor grosse Herausforderungen. Besonders betroffen sind fichtendominierte Gebirgswälder, die grossflächig verbreitet sind und häufig eine zentrale Schutzfunktion gegenüber Naturgefahren erfüllen. Die WSL erarbeitet gemeinsam mit der Praxis Grundlagen zur Priorisierung der Bewirtschaftung dieser Wälder unter dem Einfluss extremer Störungen. Dazu werden räumliche Daten zu Waldstruktur, Standort, Störungsanfälligkeit und Naturgefahren auf Landschaftsebene mit waldbaulichen, planerischen und wirtschaftlichen Aspekten verknüpft und in einem interaktiven Dashboard visualisiert.
SchutzwaldverlustReferenzen:
Bont LG, Blatter C, Rath L, Schweier J (2025). Automatic detection of forest management units to optimally coordinate planning and operations in forest enterprises. Journal of Environmental Management 372: 123276. Link
Hobi M., Brandes T., Bebi P., Helzel K., Bottero A., Bührle L., … (2025) Bewirtschaftung von fichtendominierten Gebirgswäldern im Kontext extremer Störungen. In: Björnsen A., Zimmermann N. (Red.) Forum für Wissen 2025: Extremes. WSL Ber. 164, 49–59. Link
WSL (2023). Zwischenergebnissse des 5. Landesforstinventars LFI. Der Schweizer Wald leidet unter Wetterextremen. Medienmitteilung 30.5.2023. Link -
Waldbrand
Wann, wo, wie oft, warum und wie intensiv Wälder brennen, hängt von vielen Faktoren ab. Kurzfristig wird die Waldbrandgefahr vor allem von extremer Trockenheit beeinflusst, oft kombiniert mit hohen Temperaturen oder starken Winden, die das brennbare Material entzündbar machen. Langfristig sind neben der Klimaänderung die Landnutzung und der Bevölkerungsdruck entscheidend. Der Rückgang der herkömmlichen Landwirtschaft in den ländlichen Landesteilen und die in den letzten Jahren häufiger gewordenen langanhaltenden Dürren weisen auf eine mögliche Verschärfung des Phänomens hin.
WaldbrandReferenz:
Pezzatti G.B., Conedera M., Ferriroli D., Ghiringhelli A., Ballmer M., Beyeler S. (2025) Waldbrände im Klimawandel: ist die Schweiz bereit?. In: Björnsen A., Zimmermann N. (Red.) Forum für Wissen 2025: Extremes. WSL Ber. 164, 61–72. Link
Freisetzung Kohlenstoff nach Waldbrand:
Santín C. et al. (2016) Towards a global assessment of pyrogenic carbon from vegetation fires. Global Change Biology 22(1): 76-91. Link -
Borkenkäfer
BorkenkäferBorkenkäfer am WSL (Website)
-
CO₂-Bilanz