Die Chance auf ein besseres Szenario haben wir leider schon vor einigen Jahren verpasst.
Aber hier ist ein Trostpreis für Sie.
Etwas Schokolade zum Versüssen Ihrer Naivität?
Schauen Sie sich eine realistischere Stufe an.
Ach, Sie glauben noch an heile Welt?
Dachten Sie wirklich, es gäbe noch ein besseres Szenario?
You dreamer, you.
Leider können wir die Zeit nicht umkehren.
Früher ist endgültig vorbei.
Mit der Realität können Sie nicht umgehen?
Schon ok, wir haben was für Sie.

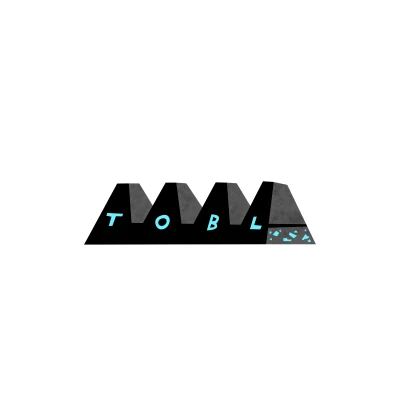


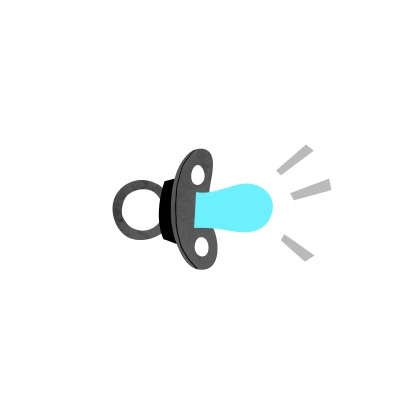

Waldbrände treten hauptsächlich im späten Winter, Frühjahr und Sommer auf, wenn die Streuschicht, der Humus und die Vegetation ausgetrocknet sind. Vor allem in den Alpen und auf der Alpensüdseite betreffen sie grössere Flächen. Abgesehen von Blitzschlag sind meist die menschliche Fahrlässigkeit bei Grillfeuern oder das Entsorgen von Cheminéeasche die Ursache.
Kleine Waldbrände, die in Perioden mit nicht besonders hoher Gefahr ausbrechen, sind keine Katastrophe. Sie können zur Struktur- und Artenvielfalt beitragen – und die Feuerwehr hat die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in der Bekämpfung von Waldbränden zu testen!
-
Abgestorbenes Pflanzenmaterial kann kleinere Feuer begünstigen, die zumeist vom Menschen verursacht werden. Zurück zu Baumvitalität
-
Seltene, kleinflächige Waldbrände fördern die Sukzession und schaffen neue Lebensräume, die von lichtliebenden Arten besiedelt werden. Dadurch können sie zur Schutzwaldverjüngung beitragen.
Grössere Waldbrände an steilen Lagen hingegen können Erosion und Murgänge zur Folge haben, weil die stabilisierende Wirkung der Wurzeln wegfällt. Weiter zu Schutzwaldverlust -
Mehr abgestorbenes Pflanzenmaterial kann kleinere Feuer begünstigen. Zurück zu Biodiversität
-
Ein Waldbrand zerstört Biomasse und führt kurzfristig zu einem starken CO₂-Ausstoß. Langfristig hängt die Bilanz davon ab, wie gut sich der Wald regeneriert und ob der Boden seine Kohlenstoffspeicherung zurückgewinnt. Weiter zu CO₂-Bilanz
Auch auf der Alpennordseite treten im Sommer wiederholt Waldbrände auf, oft durch Blitzschläge ausgelöst. Durch die zunehmende Sommertrockenheit erhöht sich diese Gefahr.
Wegen klimawandelbedingter Trockenperioden können die Brände länger andauern und grossflächiger werden.
Wärmere Winter, weniger Schnee und ein früheres Auftauen führen zu einer Ausdehnung schneefreier Gebiete, wodurch das Waldbrandrisiko auch im Winter steigt.
-
Die Zunahme von abgestorbenem Pflanzenmaterial führt regional zu grösseren Feuern, auch nördlich der Alpen. Zurück zu Baumvitalität
-
Häufige Brände schwächen die Schutzwirkung der Gebirgswälder gegen Steinschlag und Lawinen. Der Boden versiegelt und erodiert, und muss unter Umständen künstlich stabilisiert werden. Weiter zu Schutzwaldverlust
-
Das abgestorbene Pflanzenmaterial führt regional zu grösseren Feuern, auch nördlich der Alpen. Zurück zu Biodiversität
-
Waldbrände setzen CO₂ frei und die verbrannte Vegetation kann kein CO2 mehr aufnehmen. Sobald der Wald wieder wächst, nimmt er auch wieder CO₂ auf. Aber das dauert. Weiter zu CO₂-Bilanz
Waldbrände werden immer häufiger, länger und intensiver. Infolge mehrjähriger Trockenheit treten sie in allen Landesteilen auf. In den Alpen können die extremeren Bedingungen Löschaktionen zum Scheitern bringen, so dass es öfter zu Grossbränden kommt.
Auch Infrastrukturen und Siedlungen sind zunehmend bedroht. Weil es nicht mehr gelingt, genügend Löschkapazität zu organisieren, um alle Brandflächen zu bekämpfen, liegt der Fokus verstärkt auf Mensch und Infrastruktur.
Wo löschen und wo lodern lassen? Diese Frage stellt sich immer öfter.
-
Wenn das Totholz nicht grossflächig entfernt werden kann, kann es in allen Regionen der Schweiz immer wieder zu Grossbränden kommen. Zurück zu Baumvitalität
-
Waldbrände schaffen grosse Lücken, die die Schutzwirkung massiv verringern. Es müssen künstliche Verbauungen und Schutznetze geschaffen werden, um Siedlungen, Strassen und Infrastrukturen zu sichern. Weiter zu Schutzwaldverlust
-
Das abgestorbene Pflanzenmaterial führt regional zu grösseren, langanhaltenden Feuern, auch nördlich der Alpen. Zurück zu Biodiversität
-
Brennt der Wald, wird ein Grossteil des Kohlenstoffs in die Atmosphäre freigesetzt (85-95%). Nur ein geringer Anteil (5-15%) bleibt als verkohltes Material zurück und wird längerfristig im Boden gebunden. Weiter zu CO₂-Bilanz
Das wars. RIP.
Jetzt haben Sie's übertrieben.
Vielleicht eine Stufe zurückfahren?
Verstanden, sie mögen es wirklich extrem.
Game over.
Versuchen Sie es mit einer anderen Stufe.
So extrem also? Den passenden Soundtrack dazu finden Sie hier.
Mit diesem Planeten sind wir durch.
Auf zum nächsten!
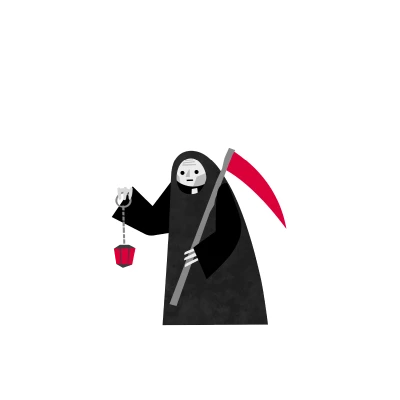



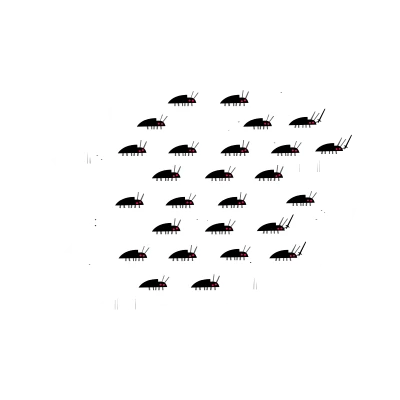
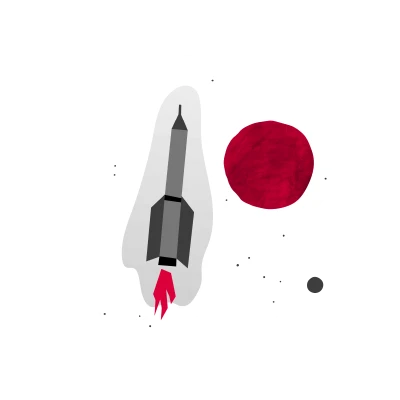
Massnahmenfür: Waldbrand
Information, Bildung, sowie die Einschätzung und Veröffentlichung der Waldbrandgefahrenstufe können die Zahl der (menschenverursachten) Brandherde verringern. Forstpolitische Massnahmen und Waldpflege reduzieren das Brandgut im Wald und senken das Risiko von Bränden.
Kommt es trotzdem zum Waldbrand, braucht es eine gute Organisation des Forstdienstes und der Feuerwehr, inklusive Helikopter. Kantonale Alarmzentralen, gestaffeltes Aufgebot der Feuerwehr, sowie Übungen und Nachbereitungen verbessern die Effizienz. Materialstützpunkte und künstlich angelegte Wasserteiche verbessern die Verfügbarkeit von Löschmaterial.
Zum Post-Brand-Management gehört die Einschätzung von Brandschwere und Bestandesresilienz, die Erfassung in der «Swissfire» Datenbank und dann die langfristigen waldbauliche Wiederinstandstellung.