Die Chance auf ein besseres Szenario haben wir leider schon vor einigen Jahren verpasst.
Aber hier ist ein Trostpreis für Sie.
Etwas Schokolade zum Versüssen Ihrer Naivität?
Schauen Sie sich eine realistischere Stufe an.
Ach, Sie glauben noch an heile Welt?
Dachten Sie wirklich, es gäbe noch ein besseres Szenario?
You dreamer, you.
Leider können wir die Zeit nicht umkehren.
Früher ist endgültig vorbei.
Mit der Realität können Sie nicht umgehen?
Schon ok, wir haben was für Sie.

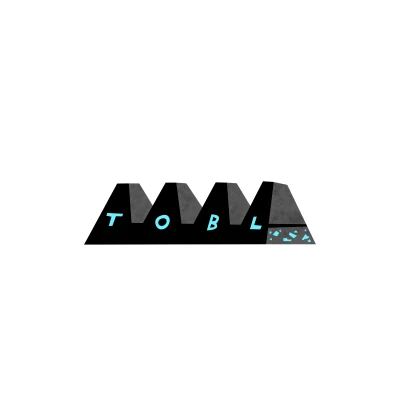


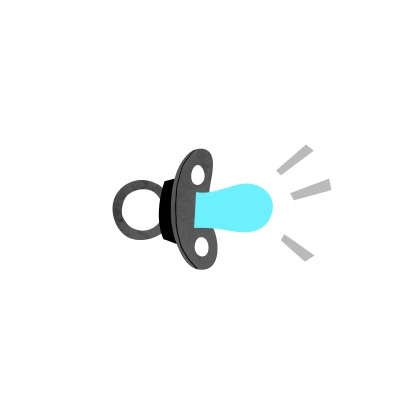

Aus der Distanz sehen die Schweizer Wälder noch fast so aus, wie vor 20 Jahren. Schaut man genauer hin, sind sie deutlich trockener geworden: einzelne Baumarten stehen unter Stress. Das macht sie anfälliger auf Krankheiten und Schädlinge.
Lokal sterben die Fichte, die Buche im Mittelland und die berühmten Föhrenwälder in Walliser Tieflagen ab.
-
Abgestorbenes feines Pflanzenmaterial (Reisig) kann die Entstehung und Verbreitung kleinerer Feuer begünstigen, dies insbesondere in der Nähe von Siedlungen oder Verkehrswegen, wo der Mensch oft Brände verursacht. Weiter zu Waldbrand
-
Wo die Vitalität von Bäumen abnimmt, vermindert sich auch ihre stabilisierende Wirkung für den Boden. Weiter zu Gravitative Naturgefahren
-
Wälder speichern CO2. Vor allem in tieferen Lagen kann die Speicherkapazität wegen Trockenheit und Hitze deutlich abnehmen, was wiederum schlecht fürs Klima ist. Weiter zu CO₂-Bilanz
-
Gesunde Wälder spielen eine wichtige Rolle bei der Speicherung von Wasser. Sie halten das Wasser im Boden und schützen vor Hochwassern. Zurück zu Wasserhaushalt
-
Insbesondere in tiefer gelegenen Fichtenwäldern nimmt der Borkenkäferbefall zu und bringt bereits geschwächte Bäume zum Absterben. Weiter zu Borkenkäfer
-
Die Verjüngung der Schutzwälder mit klimaangepassten Baumarten wird immer anspruchsvoller. Weiter zu Schutzwaldverlust
-
Bäume entwickeln verschiedene Strategien, um mit leicht erhöhtem Hitzestress umzugehen. Beispielsweise passen sie die Blattstellung an. Zurück zu Hitze
Die zunehmende Trockenheit kann gebietsweise ein massives Baumsterben auslösen. Diese Veränderungen werden unsere Landschaft neu prägen.
Davon können verschiedene Waldfunktionen wie die Holzproduktion und der Erholungswert betroffen sein!
-
Trockene Äste, die vermehrt zu Boden fallen, erhöhen die Brandgutmenge und Feuerintensität. Zusätzlich erschweren sie die Löscharbeiten am Boden. Weiter zu Waldbrand
-
Vermehrt auftretende natürliche Störungen können die Gefahr von Steinschlägen und Rutschungen im steilen Gelände erhöhen. Weiter zu Gravitative Naturgefahren
-
Durch das vermehrte Absterben von Bäumen werden die Wälder in der Schweiz zunehmend selbst zu einer CO2-Quelle. In bisher kältelimitierten Gebirgswäldern nimmt die Speicherkapazität eher zu. Weiter zu CO₂-Bilanz
-
Mit dem Austrocknen von Waldböden sinkt die Fähigkeit der Wälder, Wasser zu speichern. Wird das Wasser nicht ausreichend zurückgehalten, kann das zu grösseren Überschwemmungen führen. Zurück zu Wasserhaushalt
-
Nicht nur in tieferen Lagen, sondern auch in höher gelegenen Fichtenwäldern steigt der Borkenkäferbefall stark an. Weiter zu Borkenkäfer
-
Die Schutzwaldpflege steht unter enormem Zeit- und Ressourcendruck, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Weiter zu Schutzwaldverlust
-
Bäume nehmen bei höheren Temperaturen weniger CO₂ auf und verlieren gleichzeitig mehr Wasser durch Verdunstung. Dies führt zu einer schlechteren Photosynthese und kann langfristig das Wachstum und die Gesundheit der Bäume beeinträchtigen. Zurück zu Hitze
Hohe Temperaturen und extreme Trockenheit schwächen auch die überlebenden Bäume stark. Sie nehmen weniger CO₂ auf, verlieren mehr Wasser und wachsen langsamer. In fast allen Regionen sterben Bäume grossflächig ab – selbst tolerante Arten zeigen erste Ausfälle.
Die Wälder, wie wir sie kennen, verändern sich grundlegend.
-
Tote Nadelbäume erhöhen die Gefahr von Kronenbrand nur kurzfristig, solange die Nadeln noch dran sind. Andere stehende Totholzbäume beeinflussen die Waldbrandgefahr kaum. Weiter zu Waldbrand
-
Wo die Schutzwirkung des Waldes abnimmt, steigt das Risiko für Steinschlag, Rutschungen und Murgänge stark an. Weiter zu Gravitative Naturgefahren
-
Die Wälder in der Schweiz werden grossflächig zu erheblichen CO2-Quellen, da sie weit mehr CO2 freisetzen, als sie noch binden können. Weiter zu CO₂-Bilanz
-
Durch die extreme Abnahme der Wasserrückhaltefähigkeit von stark ausgetrockneten Waldböden kommt es nach Starkniederschlägen in vielen Regionen zu massiven Überschwemmungen. Zurück zu Wasserhaushalt
-
Der Borkenkäferbefall wird in allen Fichtenwäldern aller Höhenstufen zunehmend zu einem massiven Problem. Weiter zu Borkenkäfer
-
Das vermehrte Auftreten grossflächiger Störungen erfordert eine klare Priorisierung der Schutzwaldbewirtschaftung. Weiter zu Schutzwaldverlust
-
Der zunehmenden Hitzestress schwächt Bäume immer stärker und sie sterben ab. Zudem begünstigt die Wärme das Wachstum von schädlichen Organismen (z.B. Borkenkäfer oder Pilzkrankheiten). Zurück zu Hitze
Das wars. RIP.
Jetzt haben Sie's übertrieben.
Vielleicht eine Stufe zurückfahren?
Verstanden, sie mögen es wirklich extrem.
Game over.
Versuchen Sie es mit einer anderen Stufe.
So extrem also? Den passenden Soundtrack dazu finden Sie hier.
Mit diesem Planeten sind wir durch.
Auf zum nächsten!
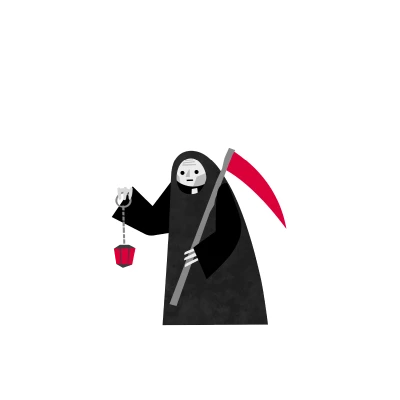



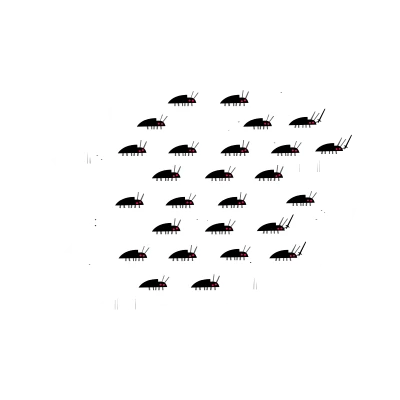
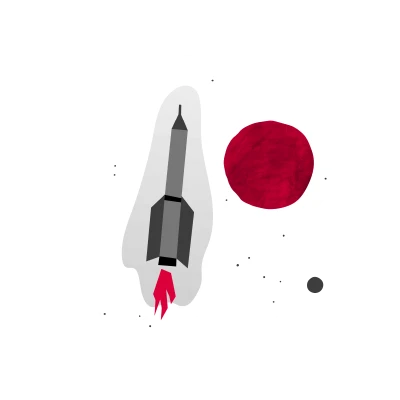
Massnahmenfür: Baumvitalität
Die Forstwirtschaft muss begrenzte Ressourcen gezielt einsetzen, um Wälder gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels resilient und widerstandsfähig zu machen und die Schutzfunktionen zu erhalten. Je nach Region kommen dabei zwei Strategien zum Einsatz: Wo waldbauliche Massnahmen wirksam sind, wird der Wald mit Unterstützung von Bund und Kantonen gezielt umgebaut – durch abgestufte Holzschläge, natürliche Verjüngung oder Pflanzung klimaangepasster Baumarten. Für letzteres ist vielerorts eine Anpassung des Wildbestandes (Rehe, Gemsen, etc.) notwendig. Wo Eingriffe nur wenig wirksam sind, werden Wälder teils als Naturschutzgebiete ausgewiesen.
Als Entscheidungshilfen liegen verschiedene WebTools vor: Die TreeApp unterstützt standortspezifisch die Wahl geeigneter Baumarten für drei Klimaszenarien. Die WebTools FORTE (Forest Tree Explorer) und FORTE Future bietet Informationen zum aktuellen Waldzustand und dessen zukünftige Entwicklung. Dazu gehört zum Beispiel die Eignung von über 30 Baumarten in der Schweiz und ihre potenzielle Verbreitung in der Gegenwart.