Die Chance auf ein besseres Szenario haben wir leider schon vor einigen Jahren verpasst.
Aber hier ist ein Trostpreis für Sie.
Etwas Schokolade zum Versüssen Ihrer Naivität?
Schauen Sie sich eine realistischere Stufe an.
Ach, Sie glauben noch an heile Welt?
Dachten Sie wirklich, es gäbe noch ein besseres Szenario?
You dreamer, you.
Leider können wir die Zeit nicht umkehren.
Früher ist endgültig vorbei.
Mit der Realität können Sie nicht umgehen?
Schon ok, wir haben was für Sie.

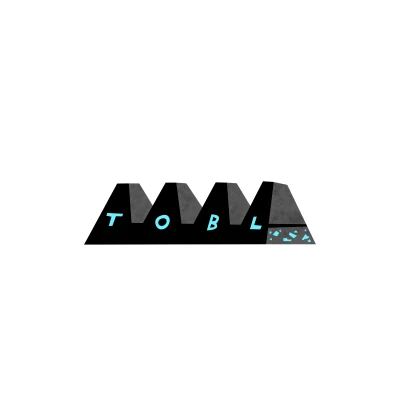


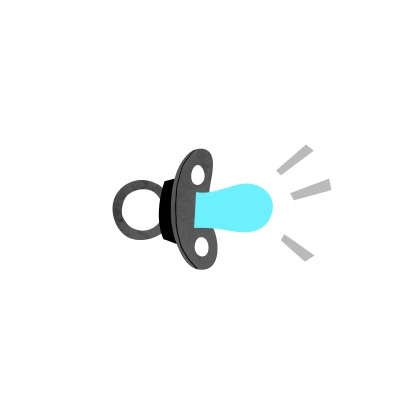

Rund zwei Drittel des Verbrauchs in der Schweiz basiert auf fossilen Energieträgern, die grösstenteils per Schiff in die Schweiz kommen. Bei Niedrigwasser und damit eingeschränkter Schifffahrt steigen die Transportkosten.
Die fortlaufende Elektrifizierung ist wirtschaftlich vielversprechend, da die Elektrizität einen höheren Wirkungsgrad hat und lokal hergestellt werden kann. Die Schweiz setzt neben Atomstrom vor allem auf Wasserkraft – zu fast 60%, Stand 2022.
Wasserkraft ist aber von den Launen des Wetters betroffen.
Heute fliesst im Winter weniger Wasser in den Flüssen, was die Wasserkraftproduktion in der kalten Jahreszeit reduziert - ausgerechnet dann, wenn die Nachfrage am grössten ist! Im Winter wird zudem auch weniger Solarstrom produziert.
-
Seit dem Bau von Wasserkraftreservoiren haben die maximalen Abflussspitzen aufgrund von Starkregenereignissen abgenommen. Zurück zu Wasserhaushalt
-
Die Wasserkraftwerke profitieren heute vom zusätzlichen Schmelzwasser aus den Gletschern. Zurück zu Gletscherschwund
Schnee und Gletscher wirken als Wasserspeicher, oder Puffer, für die Wasserkraft. Bisher.
Auf der einen Seite steht im Winter künftig mehr Wasser, in Form von Regen statt Schnee, direkt zur Verfügung. Kraftwerke mit grossen, saisonalen Stauseen und bedeutenden Gletschervorkommen profitieren anfänglich noch von mehr Schmelzwasser. Je nach Standort schwindet aber mit der Zeit dieser Effekt, zusammen mit den Gletschern.
Andererseits geht im Sommer bei Trockenheit die Produktivität zurück. Dafür wird mehr Strom über Photovoltaik generiert. Der Niederschlag fehlt dann jedoch im Übergang zum Winter, wenn die Speicherseen nicht gefüllt sind.
-
Die Frage nach der Wasserverteilung spitzt sich zu: beispielsweise mit Nutzungen für die künstliche Beschneiung, Bewässerung, Kühlung und für die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen der Gewässerräume. Zurück zu Wasserhaushalt
-
Loses Gesteinsmaterial aus Gletscherrückzugsgebieten lagert sich in Stauseen der Wasserkraftwerke ab, womit weniger Wasser für die Stromproduktion zur Verfügung steht. Zurück zu Gletscherschwund
Die Wasserkraft ist der Niederschlagsverteilung immer mehr ausgeliefert. Im Winter herrscht zunehmend Trockenheit und im Frühjahr können die Speicherseen nicht mehr gefüllt werden, weil das Wasser z.B. für Bewässerung gebraucht wird und die Restwassermengen für den Gewässerschutz erhöht werden.
Wenn die Pegelstände zu tief fallen und die Wassertemperaturen zu hoch werden, fallen auch die meisten Atomkraftwerke aus, weil der Reaktor nicht mehr ausreichend gekühlt werden kann.
Ohne griffige Klimaschutzmassnahmen und regulatorische Richtlinien könnte der Schweiz der Saft ausgehen.
-
Der Niederschlagsmangel betrifft nicht nur die Wasserkraft, sondern die gesamte Wasserwirtschaft, die Wasser für Kühlzwecke, Bewässerung, als Lebensgrundlage und als Lebensraum benötigt. Diese Verteilfragen können sich bis hin zu regionalen Konflikten zuspitzen, wie sie schon heute bspw. im benachbarten Österreich oder Frankreich vorkommen. Zurück zu Wasserhaushalt
-
In den Gletscherrückzugsgebieten könnten neue Stauseen und Wasserkraftwerke entstehen. Zurück zu Gletscherschwund
Das wars. RIP.
Jetzt haben Sie's übertrieben.
Vielleicht eine Stufe zurückfahren?
Verstanden, sie mögen es wirklich extrem.
Game over.
Versuchen Sie es mit einer anderen Stufe.
So extrem also? Den passenden Soundtrack dazu finden Sie hier.
Mit diesem Planeten sind wir durch.
Auf zum nächsten!
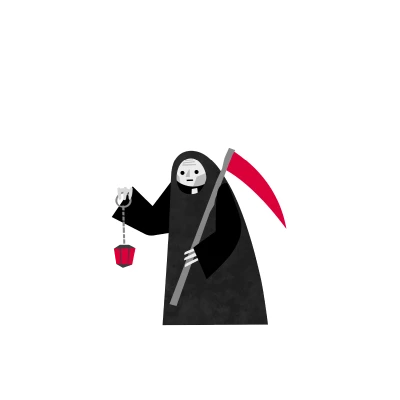



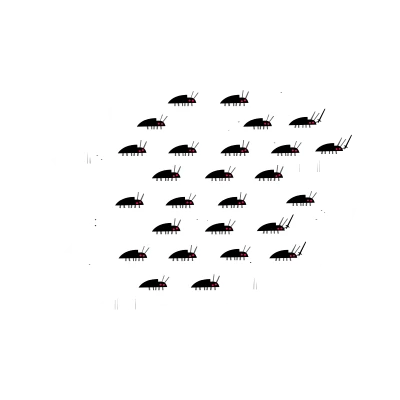
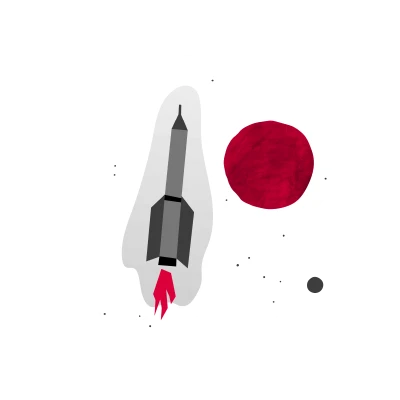
Massnahmenfür: Energieproduktion
Der Ausbau von erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft ermöglicht eine sogenannte Hybridisierung der Systeme, indem sich mehrere Energieträger ergänzen und damit sowohl die Abhängigkeit von natürlichen Systemen, als auch der Druck auf die Umwelt reduziert wird. Eine Hybridisierung kann regional sogar zu höheren Restwassermengen führen, bei gleichbleibender Wasserkraftproduktion.
Am "Runden Tisch Wasserkraft" wurden verschiedenen Standorte eruiert, wie z.B. in Gletscherrückzugsgebieten, wo neue Stauseen gebaut, oder bestehende Staumauern erhöht werden können. Dabei geht es in erster Linie um eine grössere Speicherkapazität, um genügend Winterstrom zu haben.
Neue und bisherige Stauseen können ohne grosse Zusatzbelastungen als Mehrzweckspeicher für Stromproduktion, Trinkwasserversorgung, Hochwasserschutz, Bewässerung und ökologischen Ausgleich genutzt werden.