Die Chance auf ein besseres Szenario haben wir leider schon vor einigen Jahren verpasst.
Aber hier ist ein Trostpreis für Sie.
Etwas Schokolade zum Versüssen Ihrer Naivität?
Schauen Sie sich eine realistischere Stufe an.
Ach, Sie glauben noch an heile Welt?
Dachten Sie wirklich, es gäbe noch ein besseres Szenario?
You dreamer, you.
Leider können wir die Zeit nicht umkehren.
Früher ist endgültig vorbei.
Mit der Realität können Sie nicht umgehen?
Schon ok, wir haben was für Sie.

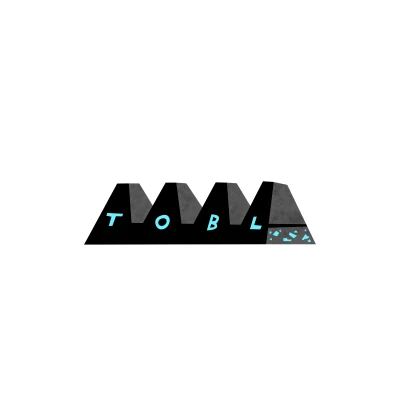


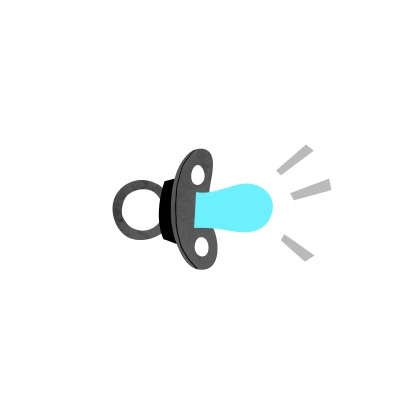

«Felsenfest» ist ein trügerisches Wort, zumindest wenn es um die Schweizer Berge geht. Dass uns diese nicht unter den Füssen (und Strassen und Siedlungen) wegkrümeln, ist unter anderem dem Schutzwald zu verdanken. Er stabilisiert die Hänge gegen Erosion und schützt darunterliegende Gebiete vor Steinschlag und Lawinen.
Der Klimawandel setzt dem Schutzwald zu. So auch dem fichtendominierten Bergwald, der in den Alpen mehr als die Hälfte der Waldfläche ausmacht. Er leidet zunehmend unter Hitze und Trockenstress und wird anfällig gegenüber grossflächigen Störungen durch Wind, Schnee und Borkenkäfer.
Die Verjüngung solcher Wälder mit klimaangepassten Baumarten ist oft erschwert, besonders in Kombination mit Schädlingen und der Belastung durch Wildtiere wie Rehe, Gämsen und Hirsche.
-
Die Verjüngung von Baumarten in Schutzwäldern wird durch die Veränderung der Artenzusammensetzung erschwert. Zurück zu Biodiversität
-
Wo die Schutzfunktion beeinträchtigt wird, erhöht sich die Gefahr von Steinschlag, Rutschungen oder Lawinen. Weiter zu Gravitative Naturgefahren
-
Seltene, kleinflächige Waldbrände können neue Habitate schaffen, die von lichtliebenden Arten besiedelt werden. Dadurch können sie zur Schutzwaldverjüngung beitragen. Zurück zu Waldbrand
-
Die Pflege der Schutzwälder wird immer anspruchsvoller und vermehrte Eingriffe werden nötig. Zurück zu Baumvitalität
-
Die von Borkenkäfern bevorzugte Fichte ist ein wichtiger Bestandteil von Schutzwäldern. Zurück zu Borkenkäfer
Vermehrt sterben Bäume wegen langanhaltender Trockenheit und Hitze ab. Betroffen sind insbesondere bisherige Hauptbaumarten wie die Buche und die flachwurzelnde Fichte.
Seit dem späten 19. Jahrhundert hat die Waldfläche der Schweiz stark zugenommen. Vielerorts wurde mit der schnellwachsenden Fichte aufgeforstet, um die Forstwirtschaftserträge zu maximieren. Solche Wälder sind meist eintönig und anfällig für Borkenkäfer und andere Störungen.
Der Druck auf ungeplante Zwangsnutzungen wächst - und mit ihm die Notwendigkeit der knallharten Priorisierung: Wo wird totes Holz geerntet und wo in die Schutzfunktion von morgen investiert?
-
Die Verjüngung von Baumarten in Schutzwäldern wird durch die starke Veränderung der Artenzusammensetzung erschwert. Zurück zu Biodiversität
-
Wenn Schutzwälder lichter werden oder grossflächig gestört werden, können Lawinen, Steinschläge und Erdrutsche an Orten auftreten, die bisher nicht betroffen waren. Weiter zu Gravitative Naturgefahren
-
Häufige Brände schwächen die Schutzwirkung der Gebirgswälder gegen Steinschlag und Lawinen. Der Boden versiegelt und erodiert, und muss unter Umständen künstlich stabilisiert werden. Zurück zu Waldbrand
-
Die Schutzwaldpflege steht unter enormem Zeit- und Ressourcendruck, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Zurück zu Baumvitalität
-
Die Ausbreitung des Borkenkäfers schwächt die Wirksamkeit von Fichten in Schutzwäldern. Zurück zu Borkenkäfer
Es treten grossflächige, bisher kaum vorstellbare Störungsereignisse auf. Besonders betroffen sind fichtendominierte Schutzwälder.
Störungsereignisse können unerwartete Kettenreaktionen auslösen. Wenn z.B. Windwurf den Wald zerstört und der Boden erodiert, kann ein Starkregenereignis einen Murgang auslösen – dann guet Nacht am Sächsi.
An exponierten Stellen, wo der Wald eine direkte Schutzfunktion erfüllt, kann diese durch das Störereignis stark beeinträchtigt werden. Dann braucht es aufwändige Absicherungen und Neubepflanzungen. Diese Arbeit ist aufwändig und stellenweise schwierig. Es muss sorgfältig priorisiert werden.
Die starke Zunahme von Störungen birgt durchaus auch Chancen, wie die Förderung klimafitter Arten und die frühzeitige Anpassung des Schutzwaldes an die Zukunft.
-
Die Verjüngung von Baumarten in Schutzwäldern wird durch das starke Verändern der Artenzusammensetzung massiv erschwert. Zurück zu Biodiversität
-
Einige Verkehrswege und Siedlungen im Alpenraum sind durch neue Lücken im Schutzwald weniger gut vor gravitativen Naturgefahren geschützt. Weiter zu Gravitative Naturgefahren
-
Waldbrände schaffen grosse Lücken, welche die Schutzwirkung massiv verringern. Ohne Stabilisierung müssen Siedlungen evakuiert oder Strassen und Schienen gesperrt werden. Zurück zu Waldbrand
-
Das grossflächige Absterben von Bäumen erfordert aufwändige Verbauungen, um die Hänge zu stabilisieren. Zurück zu Baumvitalität
-
Das grossflächige Absterben von Fichten beeinträchtig die Schutzwälder stark. Zurück zu Borkenkäfer
Das wars. RIP.
Jetzt haben Sie's übertrieben.
Vielleicht eine Stufe zurückfahren?
Verstanden, sie mögen es wirklich extrem.
Game over.
Versuchen Sie es mit einer anderen Stufe.
So extrem also? Den passenden Soundtrack dazu finden Sie hier.
Mit diesem Planeten sind wir durch.
Auf zum nächsten!
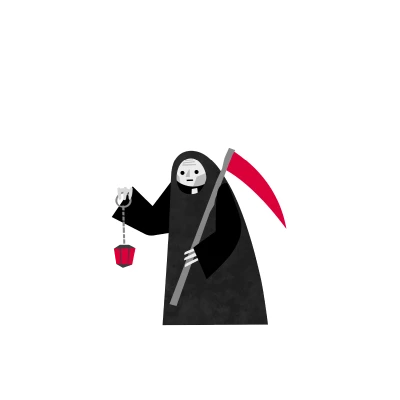



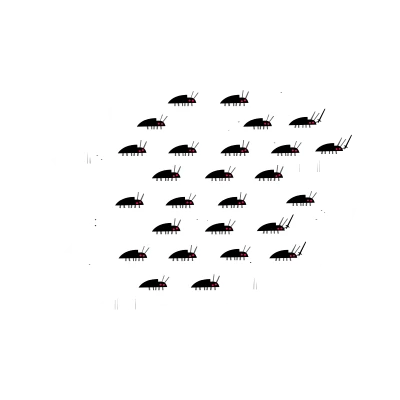
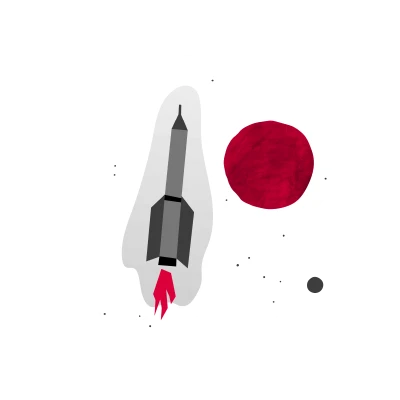
Massnahmenfür: Schutzwaldverlust
Das MountEx-Projekt erarbeitet zur Zeit ein Webtool, das dabei hilft, die Prioritäten bei der Schutzwaldbewirtschaftung im Hinblick auf extreme Störungen und im Nachgang von extremen Störungen optimal zu setzen.
In der proaktiven Waldbewirtschaftung können Vorbereitungen für künftige Entwicklungen und Klimaereignisse getroffen werden, indem bei Neupflanzungen auf Vielfalt und (zukünftige) Klimaverträglichkeit der Baumarten geachtet wird – vor allem da, wo einförmige Fichtenwälder vorherrschen. Wo zu viele Wildtiere die jungen Bäume gefährden, müssen deren Zahlen über die Jagd reguliert werden
Reaktive Massnahmen nach dem Ereignis müssen gut vorbereitet sein und gezielt dort erfolgen, wo sie am meisten zur Risikominderung beitragen und nicht neue Risken zu Folge haben (z.B. Gefährdung der Waldarbeiter und Waldarbeiterinnen).